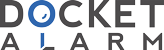`® Offenlegungsschrift
`® DE 1 03 07 696 A 1
`
`@ Int. Cl.l:
`F 04 D 13/06
`F 04 D 15/00
`F 04 D 29/40
`F04 D 29/18
`B 29 C 70/00
`H 02 K 19/02
`
`® Aktenzeichen:
`@ Anmeldetag:
`@ Offenlegungstag:
`
`103 07 696.4
`21. 2.2003
`2. 10. 2003
`
`@ BUNDESREPUBLIK
`DEUTSCHLAND
`
`DEUTSCHES
`PATENT- UNO
`MARKENAMT
`
`Mit Einverstandnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemaB § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG
`
`w
`Q
`
`@ Erfinder:
`gleich Anmelder
`
`13.09.2002
`
`@ lnnere Prioritiit:
`102 42 714. 3
`® Anmelder:
`Stephan, Hubert, 96142 Hollfeld, DE
`® Vertreter:
`Benninger, J., Dipl.-lng., Pat.-Anw., 93047
`Regensburg
`
`Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
`® Forderpumpe und verstellbares Forder-, Drossel- und Absperrelement fUr Flu ide
`@ Die Erfindung betrifft eine steuerbare Fi:irderpu mpe (2)
`fu r Fluide, mit einem in einem Gehause (6) drehbar gala(cid:173)
`gerton Rotor (8), der an seinem Umfang eine Mehrzahl
`von Pennanentmagneten (12) und in gl eich ma f~ige r Ab(cid:173)
`folge nebeneinander angeordnete Schaufelabschnitte
`(34) aufweist.
`Die Erfindung betrifft weiterhin ein verstellbares Fi:irder-,
`Drossel- und Absperrelement (4) fur Fluide, mit einem in
`einem Gehiiuse (6) drehbar gelagerten Rotor (8), der an
`seinern Umfang eine Mehrzahl von Permanentmagneten
`(12) und in gleichmiiBiger Abfolge nebeneinander ange(cid:173)
`ordnete Schaufelabschnitte (34) und Verschlussabschnit(cid:173)
`te (36) aufweist.
`lm Gehause (6) sind jeweils zu beiden Seiten des Rotors
`(8) mit einer Gleichspannung beaufschlagbare Antriebs(cid:173)
`spulen (10) angeordnet, die als Stator einer Gleichstrom(cid:173)
`synchronmaschine fungieren und den Rotor (8) in Rotati(cid:173)
`on versetzen ki:innen.
`
`Z2.
`
`20
`
`...
`~
`CD en
`CD
`I'
`0
`M
`
`0 ...
`
`w
`Q
`
`PAGE 1 OF33
`
`PETITIONERS' EXHIBIT 1109
`
`BUNDESDRUCKEREI 08.03 103 500/831/2
`
`2
`
`
`
`DE 103 07 696 A 1
`
`1
`Beschreibung
`
`2
`ter Weise aus Kunststoff, insbesondere aus spritzgegosse(cid:173)
`nem Kunststoff gefertigt sein und zur Verbesserung der Fe(cid:173)
`stigkeit jeweils eine Faserverstiirkung aufweisen. Die Per(cid:173)
`manentmagnete des Rotors konnen vorzugsweise vom
`Kunststoff umspritzt sein, so dass sie aufgrund eines diinnen
`Kunststoffiiberzugs nicht mit dem gefi:irderten Medium in
`Kontakt kommen. Wenn auch die Spulen in gleicher Weise
`im Kunststoff des Gehauses eingebettet sind, kann die For(cid:173)
`derpumpe auch aggressive und korrosive Fluide und Medien
`10 fi:irdern, ohne dass eine Beschadigung oder ein VerschleiB
`zu befiirchten ist. Urn die Resistenz gegen Medieneinftiisse
`weiter zu verbessern, konnen die Oberftachen ggf. mit einer
`zusatzlichen Beschichtung verse hen sein, die alle Poren ver(cid:173)
`schlieBt und einen Schutz gegen Korrosion und Abrieb bie-
`ten kann.
`[0009] Bin erfindungsgemiiBes Forder-, Drossel- und Ab(cid:173)
`sperrelement fiir Fluide mit den Merkmalen des unabhangi(cid:173)
`gen Anspruchs 23 umfasst einen in einem Gehause drehba(cid:173)
`ren Rotor, der Schaufel- und Verschlussabschnitt aufweist,
`20 die mit entsprechenden Verschlusssegmenten des Gehauses
`korrespondieren. Das erfindungsgemaBe Element kann
`durch geeignete Ansteuerung des Rotors als Drosselelement
`bzw. als Verschlusselement fungieren. Die iibrige Ansteue(cid:173)
`rung des drehbaren Rotors mit den Antriebsspulen ent-
`25 spricht der bereits oben beschriebenen Forderpumpe. Hinzu
`kommen die Funktionen der prazisen Positionierung des
`Rotors in bestimmten Winkelstellungen, die mit geeigneten
`Positionierungsspulen realisiert werden kann. Auch diese
`Positionierungsspulen wirken mit den Permanentmagneten
`30 des Rotors zusammen und konnen den Rotor in bestimmte
`Winkelstellungen bringen, in denen der Durchftuss begrenzt
`oder vollig unterbunden wird.
`[0010] Die Anzahl der Positionierungsspulen und der An(cid:173)
`triebsspulen sowie die Anzahl der Pern1anentmagneten be-
`35 stimmt das erzielbare Fordervolumen sowie den realisierba(cid:173)
`ren Fordergrad der Pumpe.
`[0011] Die erfindungsgemiiBe Forderpumpe eignet sich
`bspw. als Umwalzpumpe fiir Fliissigkeiten in einer Vielzahl
`von Anwendungen. So kann sie bspw. als Klihlmittel-Um-
`40 walzpumpe im stationiiren oder mobilen Betrieb eingesetzt
`werden. Das erfindungsgemiiBe Forder-, Drossel- und Ab(cid:173)
`sperrelement kann insbesondere als Forderpumpe flir eine
`Heizungsanlage oder bspw. fiir ein Blockheizkraftwerk ein(cid:173)
`gesetzt werden. Hier ist insbesondere die Drehrichtungsum-
`45 kehr von Vorteil, da auf diese Weise ein kalter Motor vor
`dem Start mit erwiirmtem Wasser aus einem Wasserspeicher
`gesplilt werden kann. Hierzu kann das Wasser in einem obe(cid:173)
`ren Bereich des Speichers entnommen werden. Anschlie(cid:173)
`Bend kann die Drehrichtung umgekehrt werden und das
`50 durch die Motorabwiirme erhitzte Wasser wieder in den
`Speicher gefi:irdert werden.
`[0012] Auch andere Anwendungen sind moglich und
`sinnvoll, bspw. ein Einsatz in der chemischen Industrie, wo
`oftmals aggressive Medien gefi:irdert werden mlissen. Bin
`VerschleiB und unerwarteter Pumpenausfall kann bier zu
`Problemen ftihren. Die erfindungsgemaBe Forderpumpe
`bzw. das erfindungsgemaBe Forder-, Drossel- und Absperr(cid:173)
`element kann fiir diese Probleme eine Abhilfe bieten.
`[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden
`Erfindung konnen den abhangigen Ansprlichen sowie der
`nachfolgenden Figurenbeschreibung entnommen werden.
`[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Be(cid:173)
`schreibung von bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen unter
`Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlau-
`tert. Dabei zeigt:
`[0015] Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfin(cid:173)
`dungsgemaBen Forderpumpe bzw. des erfindungsgemaBen
`Forder-, Drossel- und Absperrelements,
`
`15
`
`[0001] Die Erfindung betrifft ein eine Forderpumpe sowie
`ein verstellbares Forder-, Drossel- und Absperrelement ftir
`Fluide, insbesondere ein als Forderpumpe, Durchfiussbe(cid:173)
`grenzer und/oder als Absperrelement verwendbares, elek(cid:173)
`trisch betriebenes Element.
`[0002] Forderpumpen fiir Fluide sind in zahlreichen Aus(cid:173)
`fiihrungsformen bekannt. Zur Forderung von Fliissigkeiten
`werden typischerweise Verdrangereinheiten, fiir Gase meist
`Stromungsmaschinen verwendet. Stromungsmaschinen eig(cid:173)
`nen sich jedoch in gleicher Weise als Forderpumpen fiir
`Fliissigkeiten. Sollen besonders einfach und kostengiinstig
`aufgebaute Forderpumpen zum Einsatz kommen, deren
`Wirkungsgrad keine hohe Prioritat besitzt, eignen sich ins(cid:173)
`besondere einfach aufgebaute Stromungsmaschinen mit ro(cid:173)
`tierenden Schaufelblattem o. dgl. Fiir viele Anwendungen
`ist eine Umkehrung der Stromungsrichtung sinnvoll, die je(cid:173)
`doch bei typischerweise verwendeten elektrischen Antrie(cid:173)
`ben nur durch eine aufwendige Ansteuerung realisierbar ist.
`Sollen weitere Aufgaben wie bspw. eine Durchfiussbegren(cid:173)
`zung oder eine Verschlussfunktion hinzu kommen, ist die
`Verschaltung mit zusatzlichen Bauteilen unumganglich.
`[0003] Bin der Erfindung zugrunde liegendes Problem
`wird insbesondere darin gesehen, ein variables und univer(cid:173)
`selles Forderelement zur Verfiigung zu stellen, das ggf. ei(cid:173)
`nen Durchfiuss begrenzen oder verhindern kann.
`[0004] Dieses Problem wird erfindungsgemaB durch die
`Lehre der unabhiingigen Ansprtiche geli:ist, wobei in den je(cid:173)
`weiligen abhiingigen Anspriichen Merkmale aufgefiihrt
`sind, welche die Losung in vorteilhafter und zweckmaBiger
`Weise weiter entwickeln.
`[0005] Eine erfindungsgemaBe Forderpumpe fiir Fluide
`mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ist sehr einfach aufge(cid:173)
`baut und lasst sich kostengiinstig in groBer Stiickzahl, in Se(cid:173)
`rien- und Massenfertigung herstellen. Der Forderantrieb
`umfasst einen elektrisch betriebenen Rotor mit einer Reihe
`von Permanentmagneten, der ein Rotor einer Synchronma(cid:173)
`schine ist. Durch die Anordnung des Rotors zwischen einer
`Reihe von Spulenpaaren lasst sich durch geeignete elektro(cid:173)
`nische Ansteuerung eine beliebige Drehrichtung wahlen.
`Die Forderpumpe ist auf diese Weise fiir eine Forderung in
`verschiedene Richtungen vorgesehen. Die Forderrate lasst
`sich auf einfache Weise durch eine Drehzahlsteuerung des
`Rotors wahlen.
`[0006] Die zu beiden Seiten des scheibenfi:irmigen Rotors
`angeordneten Spulen ermoglichen eine prazise Ansteuerung
`des Forderrotors und dessen Drehzahlregulierung. Die Spu(cid:173)
`len konnen in vorteilhafter Weise als auf einem Schaltungs(cid:173)
`trager aufgebrachte Flachspulen ausgebildet sein. Sie kon(cid:173)
`nen bspw. als Leiterbahnen auf dem Schaltungstrager ange(cid:173)
`ordnet sein und lassen sich auf diese Weise Ieicht und ko(cid:173)
`stengiinstig herstellen.
`[0007] Die Gehausehiilften des Gehauses weisen vorzugs(cid:173)
`weisejeweils eine Trichterform auf, die sich von einem Lei- 55
`tungsanschluss jeweils in Rich tung einer Verbindungsebene
`erweitert, so dass die Gehausehalften jeweils einen Verbin(cid:173)
`dungsfiansch zur losbaren und dichtenden Verbindung auf(cid:173)
`weisen. Der schcibenfi:irn1ige Rotor ist vorzugsweise ungc(cid:173)
`fiihr auf gleicher Hohe mit diesem als Flansch ausgestalteten 60
`Verbindungsabschnitt angeordnet, da diese Stelle den graB-
`ten Durchmesser aufweist. Urn den Rotor aufnehmen zu
`konnen, weist der Verbindungsabschnitt eine fiachzylindri(cid:173)
`sche Kontur von geringer Hohe auf. AuBen konnen die bei(cid:173)
`den Gehauseftansche bspw. miteinander verschraubt oder
`auf andere Weise lOs bar oder unli:isbar verbunden sein. So ist
`bspw. auch ein Verkleben oder VerschweiBen moglich.
`[0008] Der Rotor sowie das Gehause konnen in vorteilhaf-
`
`65
`
`PAGE 2 OF 33
`
`
`
`3
`[0016] Fig. 2 einen Uingsschnitt des Bauteils gemaB Fig.
`1,
`[0017] Fig. 3 eine schematische Explosionsdarstellung
`des Bauteils gemaB Fig. 1,
`[0018] Fig. 4 und 5 eine schematische Darstellung eines
`Rotors in Draufsicht und im Schnitt,
`[0019] Fig. 6 und 7 jeweils schematische Darstellungen
`von Gehausehalften des erfindungsgemaBen Bauteils in
`Draufsicht und
`[0020] Fig. 8 und 9 schematische Darstellungen der an- 10
`triebserzeugenden Komponenten des erfindungsgemaBen
`Bauteils.
`[0021] Anhand der folgenden Fig. 1 bis 9 wird ein erfin(cid:173)
`dungsgemaBes Bauteil erlautert, das je nach Gestaltung ei(cid:173)
`nes weiter unten zu erlautemden Rotors sowie einer von 15
`zwei aneinander geftigten Gehausehalften eine Forder(cid:173)
`pumpe 2 oder ein steuerbares Forder-, Drossel- und Ab(cid:173)
`sperrelement 4 sein kann. Aus Vereinfachungsgriinden wird
`in diesem Zusammenhang entweder von einer Forderpumpe
`2 bzw. einer Pumpe 2 oder einem Element 4 die Rede sein.
`Das mit Element 4 bezeichnete Bauteil weist die genannten
`steuerbaren Funktionen der Forderung, der Drosselung undl
`oder der Absperrung auf. Gleiche Teile sind in den Fig. 1 bis
`9 grundsatzlich mit gleichen Bezugszeichen versehen und
`brauchen daher nicht mehrfach erlautert werden.
`[0022] Das Element 4 umfasst ein Gehause 6, das aus ei(cid:173)
`ner ersten Gehausehalfte 18 (in den Fig. 1 bis 3 jeweils
`oben) und aus einer zweiten Gehausehalfte 20 (in den Fig. 1
`bis 3 jeweils unten) besteht. Beide Gehausehalften 18, 20
`sind im zusammen gebauten Zustand an einem mittleren
`Verbindungsabschnitt 26 lOsbar oder unlOsbar miteinander
`verbunden. Der Verbindungsabschnitt 26 ist als Flansch aus(cid:173)
`gestaltet, der gleichzeitig eine Fiihrungs-, Positionierungs(cid:173)
`und Dichtungsfunktion erfiillt. Im gezeigten Ausflihrungs(cid:173)
`beispiel weist die zweite (untere) Gehausehalfte 20 einen
`umlaufenden Zentriersteg 38 auf, den der Flansch der erst en
`Gehausehalfte 18 dichtend und formschliissig umgreift ( vgl.
`Fig. 2 und 3).
`[0023] Beide Gehausehalften 18, 20 sind trichterfOnnig
`ausgestaltet und veljiingen sich in entgegen gesetzter Rich(cid:173)
`tung jeweils zu einem Leitungsanschluss 24. Dieser kann je
`nach Bedarf eine beliebige Gestaltung aufweisen, bspw.
`ebenfalls als Verbindungsftansch oder als Schlauchan(cid:173)
`schluss o. dgl. ausgestaltet sein. Die beiden Gehausehalften
`18, 20 konnen entweder miteinander verschraubt sein, wo(cid:173)
`durch sie lOs bar miteinander verbunden sind. Es sind jedoch
`auch andere lOsbare Verbindungsarten moglich, bspw. mit(cid:173)
`tels Klammem, Schellen, Rasthaken o. dgl. Sollen die Ge(cid:173)
`hausehalften 18, 20 nach der Montage nicht mehr voneinan(cid:173)
`der getrennt werden, so konnen sie auch miteinander ver(cid:173)
`klebt, verschweiBt oder vemietet werden. In diesem Fall
`kann bei einem Defekt nur noch das gesamte Bauteil ausge(cid:173)
`tauscht werden, nicht mehr einzelne Teile.
`[0024]
`In einer Ebene ungefahr auf Hohe des Verbin(cid:173)
`dungsabschnittes 26 ist ein Rotor 8 drehbar gelagert, der an(cid:173)
`hand der Fig. 4 und 5 naher erlautert wird. Der Rotor 8 weist
`eine fiachzylindrische Kontur auf, mit einer Nabe 30, einem
`Umfangsring 32 und dazwischen angeordneten Schaufel(cid:173)
`blattabschnitten 34 und Verschluss- bzw. Scheibenabschnit(cid:173)
`ten 36. Mit seiner Nabe 30 ist der Rotor 8 drehbar auf einer
`Steckachse 28 der zweiten Gehausehalfte 20 gelagert. Diese
`Lagerung kann wahlweise eine Gleit- oder Walzlagerung
`sein. Sobald sich der Rotor 8 dreht, wird er von seinen An(cid:173)
`triebselementen sowie von den an ihn angreifenden Stro(cid:173)
`mungskraften des gefOrderten Fluids zentriert, so dass er im
`Idealfall den beriihrenden Kontakt mit der Steckachse 28
`verliert und gleichsam eine ftiegende Lagerung bzw. eine
`Stromungslagerung aufweist.
`
`4
`[0025] Als Antrieb des Rotors 8 kommt eine an sich be-
`kannte Gleichstromsynchronmaschine zum Einsatz. Zu die(cid:173)
`scm Zweck weist der Rotor 8 in seinem Umfangsring 32
`eine Reihe von regelmaBig voneinander beabstandeten Per(cid:173)
`manentmagneten 12 auf, die bspw. als kleine, zylindrische
`Einheiten fest im Umfangsring 32 verankert sein konnen. Im
`Verbindungsabschnitt 26 sind jeweils oberhalb und unter(cid:173)
`halb des Rotors 8, auf gleichem Umfang wie dessen Perma-
`nentmagneten 12, Antriebsspulen 10 angeordnet, die durch
`geeignete Ansteuerung fiir eine Rotation des Rotors 8 sor(cid:173)
`gen konnen. Die Antriebsspulen 10 konnen bspw. als ge-
`druckte Schaltungen auf einem ringfOrmigen Schaltungstra(cid:173)
`ger 16 aufgebracht sein. Jeweils oberhalb und unterhalb des
`Rotors 8 ist ein mit Antriebsspulen 16 versehener Schal(cid:173)
`tungstragerring 16 angeordnet. Die Antriebsspulen 10 ste(cid:173)
`hen sich vorzugsweise immer paarweise gegeniiber, so dass
`sie fiir ein magnetisches Feld in einer Richtung senkrecht
`zur Bewegungsrichtung der rotierenden Pemlanentmagne(cid:173)
`ten 12 sorgen konnen.
`20 [0026] Das Antriebsprinzip des Synchronmotors ist an(cid:173)
`hand der schematischen Darstellungen der Fig. 8 und 9 ver(cid:173)
`deutlicht. Im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel soll ein Perma(cid:173)
`nentmagnet 12 des Rotors 8 eine Bewegung von links nach
`rechts vollfiihren, die entsprechend der perspektivischen
`25 Darstellung einer Rotation entgegen des Uhrzeigersinns ent(cid:173)
`spricht. Die Polung der sich jeweils paarweise gegeniiber
`stehenden Antriebsspulen 10 wird so gewahlt, das der Per(cid:173)
`manentmagnet 12 in Richtung des Spulenpaars 10 gezogen
`wird. Kurz bevor der Magnet 12 das Spulenpaar 10 passiert,
`30 wird die Spannung abgeschaltet, so dass der Magnet an(cid:173)
`triebslos vorbei streicht. Kurz nachdem der Magnet 12 das
`Spulenpaar 10 passiert hat, wird die Spannung umgepolt, so
`dass der Magnet 10 von den Spulen 10 abgestoBen wird. Die
`Drehzahl des Rotors 8 kann durch entsprechende Ansteue-
`35 rung der Spulen gesteuert werden.
`[0027] Um den Rotor 8 in gleichmaBige und ruckfreie Ro(cid:173)
`tation zu versetzen, arbeitet der Antrieb vorzugsweise mit
`"Handshake". Damit ist eine Abschaltung des elektrischen
`Feldes kurz vor Passieren des Magneten gemeint. Eine sol-
`40 che Drehmomentliicke kann zweckmaBigerweise ca. 4 o be(cid:173)
`tragen und wird insgesamt durch die Mehrzahl von Magne(cid:173)
`ten und Spulenpaaren ausgeglichen.
`[0028] Durch Anlegen einer Spannung an die Spulen
`fiieBt durch diese ein Strom. Dieser Strom ruft in der Spule
`45 jeweils ein Magnetfeld hervor, das sich auch im Luftspalt
`aufbaut. In diesem Luftspalt befindet sich nun das Laufrad
`mit den Dauermagneten. Auf Grund des oben genannten
`Feldes werden die Magneten angezogen. Befinden sie sich
`ca. 2° vor der absoluten lJberlappung, wird der Strom abge-
`50 schaltet und gewartet, bis der Magnet 2° nach der absoluten
`lJberlappung steht. Nun wird die Spule mit einer entgegen
`gesetzten Phasenlage und Spannung beaufschlagt, so dass
`sich nun das Magnetfeld umkehrt und den Magneten ab(cid:173)
`stOBt.
`ss [0029] Die Drehzahl lasst sich auf einfache Weise durch
`elektronische Ansteuerung der Antriebsspulen 10 regulie(cid:173)
`ren. Ebenso einfach kann die Drehrichtung des Rotors 8 und
`damit die Forderrichtung der Pumpe 2 bzw. des Elements 4
`umgekehrt werden.
`60 [0030] Der Rotor 8 weist die zur FluidfOrderung notwen(cid:173)
`digen Schaufelblattabschnitte 34 auf, die im gezeigten Aus(cid:173)
`fiihrungsbeispiel jeweils von Verschlussabschnitten 36 ge(cid:173)
`trennt sind. Soll das erfindungsgemaBe Bauteillediglich als
`Forderpumpe 2 betrieben werden, konnen auch ausschlieB-
`lich Schaufelabschnitte 34 vorgesehen sein. Im gezeigten
`Ausfiihrungsbeispiel sind jeweils fiinf Schaufelabschnitte
`34 und fiinf Verschlussabschnitte 36 vorgesehen (vgl. Fig. 4
`und 5). Jeweils in gleicher Position wie die Schaufelab-
`
`DE 103 07 696 A 1
`
`65
`
`PAGE 3 OF 33
`
`
`
`DE 103 07 696 A 1
`
`5
`schnitte 34 sind im Umfangsring 32 Pennanentmagneten 12
`angeordnet, im gezeigten Ausftihrungsbeispiel somit ftinf.
`Es konnen jedoch auch wesentlich mehr Magneten 12 vor(cid:173)
`gesehen sein, womit die Forderleistung des Antriebs ent(cid:173)
`sprechend erhoht werden kann. Je mehr Magnete und Spu(cid:173)
`len vorhanden sind, desto hoher ist die erzielbare Forderlei(cid:173)
`stung. Allerdings ist die Anzahl der Spulen durch den im
`Schaltungstragerring 16 zur Verftigung stehenden Platz be(cid:173)
`grenzt. Soll die Forderleistung dennoch erhoht werden, so
`kann es notwendig sein, den AuBendurchmesser des Verbin(cid:173)
`dungsabschnittes 26 und damit des Schaltungstragerrings 26
`sowie des Rotors 8 zu vergroBern.
`[0031] Die Schaufelabschnitte 34 bestehen aus schrag ge(cid:173)
`stellten Blattern, die zwischen Nabe 30 und Umfangsring 32
`des Rotors 8 angeordnet sind. Die Schragstellung der Blatter
`ist vorzugsweise so bemessen, dass der Rotor 8 eine ge(cid:173)
`wtinschte Lange nicht tiberschreitet. Die im gezeigten Bild
`(Fig. 4) naeh unten weisenden Kanten der Schaufelblatter
`34 grenzen jeweils an cine Kante cines benachbarten Ver(cid:173)
`schlussabschnittes 36, die vorzugsweise cine gleiche Breite
`wie die Schaufelblatter 34, jedoch keine Neigung aufwei(cid:173)
`sen. D. h., sie sind als fiache Scheibensegmente ausgestaltet,
`die bei einer Rotation des Rotors 8 in geringem Abstand ab(cid:173)
`wechselnd tiber Verschlusssegmente 40 und Trichterseg(cid:173)
`mente 44 der zweiten Gehausehalfte 20 streichen.
`[0032] Deren Gestaltung wird anhand der Draufsicht der
`Fig. 6 verdeutlicht. Eine gleiche Anzahl von Trichterseg(cid:173)
`menten 44, von Verschlusssegmenten 40 wie von Ver(cid:173)
`schlussabschnitten 36 am Rotor 8 ermoglicht je nach des sen
`Steuerung eine Durchfiussbegrenzung oder einen Ver- 30
`schluss des Elements 4. Zu diesem Zweck sind neben den
`Antriebsspulen 10 jeweils eine Reihe von Positionierungs(cid:173)
`spulen 14 vorgesehen, die in Zusammenwirkung mit den
`Permanentmagneten 12 cine gezielte Drehwinkelpositionie(cid:173)
`rung des Rotors 8 ennoglichen. Da der Rotor 8 im gezeigten
`Ausfiihrungsbeispiel ftinf Pennanentmagneten 12 aufweist,
`im Verbindungsabschnitt 26 jedoch nur jeweils vier Positio(cid:173)
`nierungsspulen 14 vorgesehen sind, kann der Rotor 8 in na(cid:173)
`hezu jede gewiinschte Stellung gebracht werden. Bei dieser
`festen Positionierung sind die Antriebsspulen 10 abgeschal(cid:173)
`tet.
`[0033] So kann der Rotor 8 durch geeignete Ansteuerung
`der Positionierungsspulen 14 bspw. in eine Stellung ge(cid:173)
`bracht werden, bei der jeweils ein Verschlussabschnitt 36
`deckungsgleich tiber einem Verschlusssegment 40 der zwei(cid:173)
`ten Gehausehiilfte 20 angeordnet ist. In diesem Fall kann die
`Stromung den Rotor 8 ungehindert passieren. Es erfolgt
`keine Forderung. Werden dagegen die Verschlussabschnitte
`36 des Rotors 8 in deckungsgleiche Position tiber die Trich(cid:173)
`tersegmente 44 gebracht, so ist das Element 4 verschlossen; 50
`es kann kein Fluid mehr hindurch fiieBen. Dazwischen sind
`beliebige Zwischenstellungen moglich, in denen das Ele(cid:173)
`ment 4 als variabler Durchfiussbegrenzer fungiert. Bei abge(cid:173)
`schalteten Positionierungsspulen 14 und geeigneter An(cid:173)
`steuerung der Antriebsspulen 10 kann das Element 4 in be- 55
`liebige Richtung und mit variabler Forderrate fi:irdern.
`[0034] Die in der zweiten Gehausehalfte 20 befindlichen
`Positionierungsspulen 14 lassen sich vorzugsweise derart.
`ansteuern, dass der Rotor 8 auf die Stirnfiache der zweiten
`Gehausehiilfte 20 gezogen wird und dort fest aufiiegt. Durch 60
`eine ausreichend priizise Fertigung kann auf diese Weise
`cine anniihernde Dichtheit des geschlossenen Rotors 8 er(cid:173)
`zielt werden, so dass einem gewissen Fluiddruck standge(cid:173)
`halten werden kann.
`[0035] Wie anhand des Langsschnittes der Fig. 2 sowie 65
`der Draufsicht der Fig. 6 verdeutlicht ist, grenzen die stern(cid:173)
`fi:innig nach innen weisenden Verschlusssegmente 40 mittig
`nicht aneinander, sondem lassen einen mittigen Querschnitt
`
`6
`frei, der dem inneren Querschnitt des Leitungsanschlusses
`24 entspricht. An der Aufiagefiache des Rotors sind die obe(cid:173)
`ren Bereiche der Verschlusssegmente 40 jeweils durch den
`Ringabschnitt 42 verbunden, in dessen Mitte die senkrecht
`nach oben ragende und den Rotor 8 fest legende Steckachse
`28 angeordnet ist. Die sich mit den Verschlusssegmenten 40
`regelmaBig abwechselnden Trichterabschnitte 44 weisen an(cid:173)
`niihernd die gleiche Kontur auf wie der entsprechende
`Trichterabschnitt 22 der ersten (oberen) Gehausehalfte 18.
`10 [0036] Deren Gestaltung und glatter Ubergang in den obe(cid:173)
`ren Leitungsanschluss 24 ist anhand der sehematischen
`Draufsicht der Fig. 7 verdeutlicht.
`[0037] Weiterhin verdeutlichen die Fig. 6 und 7 die An(cid:173)
`ordnung der ringfi:im1igen Schaltungstrager 16 mit den dar-
`15 auf angeordneten Antriebsspulen 10 und Positionierungs(cid:173)
`spulen 14.
`[0038] Der Rotor 8 kann in vorteilhafter Weise aus spritz(cid:173)
`gegossenem Kunststoff gefertigt sein, der bspw. cine ver(cid:173)
`steifende Faserverstiirkung aufweist. Vorzugsweise sind die
`20 Magnete 12 gekapselt, so dass sic nicht mit dem gefi:irderten
`Medium in Kontakt kommen. Die Pennanentmagneten 12
`konnen bspw. in die Spritzgussform eingelegt und anschlie(cid:173)
`Bend in einem Schuss mit Kunststoff umspritzt werden. Auf
`dieser Weise kann der Rotor 8 in gewiinschter Gestaltung
`25 auf sehr kostengtinstige Weise in hohen Sttickzahlen herge(cid:173)
`stellt werden.
`[0039]
`In gleicher Weise konnen die beiden Gehausehalf(cid:173)
`ten 18, 20 aus spritzgegossenem Kunststoff hergestellt wer-
`den. Auch der hierfiir verwendete Kunststoff kann cine Fa(cid:173)
`serverstiirkung aufweisen. Auch hierbei kann es von Vorteil
`sein, wenn die Spulen 10, 14 gekapselt sind, um nicht mit
`dem gefi:irderten Medium in Kontakt zu kommen. Die
`Schaltungstragerringe 16 konnen in gleicher Weise in eine
`Spritzgussfom1 eingelegt und urnspritzt werden. Die An-
`35 schlusskontakte zur Ansteuerung der Spulen 10, 14 konnen
`aus dieser Form herausgefiihrt werden und dabei hennetisch
`umspritzt werden.
`[0040] Ein sinnvoller Trichterwinkel der beiden Gehause(cid:173)
`hiilften 18, 20 kann bspw. in einern Winkel von ca. 20 bis
`40 60° zur Langsachse liegen. Vorzugsweise betragt der Win(cid:173)
`kel ca. 35 bis 45°, so dass sich relativ gtinstige Strornungs(cid:173)
`verhiiltnisse ergeben.
`[0041] Als Faserverstarkung eignet sich insbesondere
`Glasfaser oder Kohlefaser. Als Kunststoff eignet sich grund-
`45 satzlich jeder spritzgieBbare Them1oplast. Ggf. konnen die
`Bauteile auch in einern Moldingverfahren aus duroplasti(cid:173)
`schem Kunststoff hergestellt werden. Die Verwendung von
`Kunststoff hat insbesondere Vorteile hinsichtlich der Me(cid:173)
`dienresistenz der Oberfiachen sowie hinsichtlich der Her-
`stellungskosten von groBen Sttickzahlen.
`[0042] Die erfindungsgemaBe Forderpumpe eignet sich
`als kostengtinstiges Massenprodukt, bspw. als Umwiilz(cid:173)
`pumpe cines Ktihlkreislaufs cines Kraftfahrzeuges o. dgl.
`Sic eignet sich hervorragend als Umwalzpumpe einer Hei(cid:173)
`zungsanlage oder auch als Forderpumpe fiir die chemische
`Industrie.
`
`Bezugszeichenliste
`
`2 Forderpurnpe
`4 Forder-, Drossel- und Absperrelement
`6 Gehause
`8 Rotor
`10 Antriebsspule
`12 Pennanentmagnet
`14 Positionierungsspule
`16 Schaltungstrager/Schaltungstragerring
`18 erste Gehausehalfte
`
`PAGE 4 OF 33
`
`
`
`DE 103 07 696 A 1
`
`7
`
`20 zweite Gehausehalfte
`22 Trichterabschnitt
`24 Leitungsanschluss
`26 Verbindungsabschnitt
`28 Steckachse
`30 Nabe (Rotor)
`32 Umfangsring (Rotor)
`34 Schaufelabschnitt/Schaufelblattabschnitt (Rotor)
`36 Verschlussabschnitt/Scheibenabschnitt (Rotor)
`38 Zentriersteg (zweite Gehausehalfte)
`40 Verschlusssegment (zweite Gehausehalftc)
`42 Ringabschnitt (zwcitc Gchauschalftc)
`44 Trichtcrscgmcnt (zwcitc Gchauschalftc)
`
`Patcntansprtichc
`
`10
`
`15
`
`1. Stcucrbarc Fordcrpumpc (2) fiir Fluidc, mit cincm
`in cincm Gchausc (6) drchbar gclagcrtcn Rotor (8), dcr
`an scincm Umfang cine Mchrzahl von Pcrmancntma(cid:173)
`gnctcn (12) und in glcichmaBigcr Abfolgc ncbcncinan- 20
`dcr angcordnctc Schaufclabschnittc (34) aufwcist, wo(cid:173)
`bci im Gchausc (6) jcwcils zu bcidcn Scitcn des Rotors
`(8) mit cincr Glcichspannung bcaufschlagbarc An(cid:173)
`tricbsspulcn (10) angcordnct sind, die als Stator cincr
`Glcichstromsynchronmaschinc fungicrcn und den Ro- 25
`tor (8) in Rotation vcrsctzcn konncn.
`2. Fordcrpumpc nach Anspruch 1, dadurch gckcnn(cid:173)
`zcichnct, dass cine Fordcrrichtung jc nach Anstcucrung
`dcr Antricbsspulcn (10) bclicbig umkchrbar ist.
`3. Fordcrpumpc nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch gc- 30
`kcnnzcichnct, dass cin Fordcrgrad in bclicbigcr Fordcr(cid:173)
`richtung durch cntsprcchcndc Anstcucrung dcr An(cid:173)
`tricbsspulcn (10) variicrbar ist.
`4. Fordcrpumpc nach cincm dcr Anspriichc 1 bis 3, da(cid:173)
`durch gckcnnzcichnct, dass dcr Fordcrgrad durch 35
`Stcucrung dcr Drchgcschwindigkcit des Rotors (8) va(cid:173)
`riicrbar ist.
`5. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`sprtichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Antricbs(cid:173)
`spulcn (10) jcwcils zu bcidcn Scitcn des flachcn Rotors 40
`(8) angcordnct sind.
`6. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`sprtichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Antricbs(cid:173)
`spulcn (10) als gcgcniibcr licgcnd angcordnctc Spulcn-
`paarc ausgcbildct sind.
`7. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Antricbs(cid:173)
`spulcn (10) jcwcils als Flachspulcn ausgcbildct sind.
`8. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Antricbs- 50
`spulcn (10) jcwcils als Lcitcrbahncn cines ringfbrmi(cid:173)
`gcn Schaltungstragcrs (16) ausgcbildct sind.
`9. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`sprtichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass das Gchausc (6)
`aus wcnigstcns zwci mitcinandcr vcrbindbarcn Halftcn 55
`(18, 20) bcstcht.
`10. Fordcrpurnpc nach Anspruch 9, dadurch gckcnn(cid:173)
`zcichnct, dass cine crstc Gchauschalftc (18) cincn Lci(cid:173)
`tungsanschluss (24) aufwcist, dcr sich trichtcrfom1ig in
`Richtung cines Vcrbindungsabschnitts (26) zu cincr 60
`zwcitcn Gchauschalftc (20) crwcitcrt.
`11. Fordcrpurnpc nach Anspruch 9 odcr 10, dadurch
`gckcnnzcichnct, dass die zwcitc Gchauschalftc (20) ci(cid:173)
`ncn wcitcrcn Lcitungsanschluss (24) aufwcist, dcr sich
`trichtcrformig in Richtung des Vcrbindungsabschnitts 65
`(26) zur crstcn Gchauschalftc (18) crwcitcrt.
`12. Fordcrpumpc nach cincrn dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr Rotor (8)
`
`45
`
`8
`ungcfahr in cincr Vcrbindungscbcnc des Vcrbindungs(cid:173)
`abschnitts (26) dcr bcidcn Gchauschalftcn (18, 20) an(cid:173)
`gcordnct ist.
`13. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr Vcrbin(cid:173)
`dungsabschnitt (26) dcr bcidcn Gchauschalftcn (18,
`20) cine flachzylindrischc Kontur aufwcist.
`14. Fordcrpumpc nach cincrn dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr Rotor (8)
`auf cincr Stcckachsc (28) mittig in dcr zwcitcn Gchau(cid:173)
`schalftc (20) roticrt.
`15. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die bcidcn Gc(cid:173)
`hauschalftcn (18, 20) lbsbar mitcinandcr vcrbundcn,
`insbesondere vcrschraubt sind.
`16. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr Rotor (8)
`aus Kunststoff gcfcrtigt ist und dass die Pcrmancntma(cid:173)
`gnctcn (12) darin cingcformt sind.
`17. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr Rotor (8)
`aus spritzgcgosscncm Kunststoff gcfcrtigt ist.
`18. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Pcmlancnt(cid:173)
`magnctcn (12) jcwcils cine zylindrischc Kontur auf(cid:173)
`wciscn und dass ihrc Stimflachcn jcwcils von cincr
`diinncn Schicht des Kunststoffcs bcdcckt sind, aus dcm
`dcr Rotor (8) gcfcrtigt ist.
`19. Fordcrpumpc nach cincrn dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die bcidcn Gc(cid:173)
`hauschalftcn (18, 20) jcwcils aus Kunststoff, insbeson(cid:173)
`dere aus spritzgcgosscncm Kunststoff gcfcrtigt sind.
`20. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass dcr aus Kunst(cid:173)
`stoff gcfcrtigtc Rotor (8) cine Fascrvcrstarkung, insbe(cid:173)
`sondere mit Glasfascm odcr mit Kohlcfascm o. dgl.,
`aufwcist.
`21. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die aus Kunst(cid:173)
`stoff gcfcrtigtcn Gchauschalftcn (18, 20) cine Fascr(cid:173)
`vcrstarkung, insbesondere mit Glasfascrn odcr mit
`Kohlcfascm o. dgl., aufwciscn.
`22. Fordcrpumpc nach cincm dcr voranstchcndcn An(cid:173)
`spriichc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Lcitungsan(cid:173)
`schliissc (24) dcr Gchauschalftcn (18, 20) jcwcils als
`Schlauchanschliissc o. dgl. ausgcbildct sind.
`23. Vcrstcllbarcs Fordcr-, Drosscl- und Abspcrrclc(cid:173)
`mcnt (4) fiir Fluidc, mit cincm in cincm Gchausc (6)
`drchbar gclagcrtcn Rotor (8), dcr an scincm Umfang
`cine Mchrzahl von Pcrmancntmagnctcn (12) und in
`glcichmaBigcr Abfolgc ncbcncinandcr angcordnctc
`Schaufclabschnittc (34) und Vcrschlussabschnittc (36)
`aufwcist, wobci im Gchausc (6) jcwcils zu bcidcn Sci(cid:173)
`ten des Rotors (8) mit cincr Glcichspannung bcauf(cid:173)
`schlagbarc Antricbsspulcn (10) angcordnct sind, die als
`Stator cincr Glcichstromsynchronmaschinc fungicrcn
`und den Rotor (8) in Rotation vcrsctzcn konncn.
`24. Element nach Anspruch 23, dadurch gckcnnzcich(cid:173)
`nct, dass dcr Rotor (8) Schaufclblattabschnittc (34)
`aufwcist, zwischen dcncn jcwcils flachc Schcibcnab(cid:173)
`schnittc (36) angcordnct sind.
`25. Element nach Anspruch 24, dadurch gckcnnzcich(cid:173)
`nct, dass die Schcibcnabschnittc (36) des Rotors (8) jc(cid:173)
`wcils tcilwcisc odcr vollstandig dcckungsglcich iibcr
`korrcspondicrcndc Vcrschlussscgmcntc (40) dcr zwci(cid:173)
`tcn Gchauschalftc (20) bringbar sind und auf dicsc
`Weise fiir cine Durchflussbcgrcnzung odcr cincn Vcr(cid:173)
`schluss sorgcn konncn.
`
`PAGE 5 OF 33
`
`
`
`5
`
`15
`
`20
`
`DE 103 07 696 A 1
`
`10
`
`9
`26. Element nach einem der Anspriiche 23 bis 25, da(cid:173)
`durch gekennzeichnet, dass die Verschlusssegmente
`( 40) in der zweiten Gehausehalfte (20) stemfOrmig an(cid:173)
`geordnet sind.
`27. Element nach einem der Anspriiche 23 bis 26, da-
`durch gekennzeichnet, dass eine gleiche Anzahl von
`Schaufelblattabschnitten (34) und Scheibenabschnitten
`(36) des Rotors (8) sowie von Verschlusssegmenten
`( 40) der zweiten Gehausehalfte (20) vorgesehen sind.
`28. Element nach einem der Anspriiche 23 bis 27, da- 10
`durch gekennzeichnet, dass die zur Mittelachse der
`zweiten Gehausehalfte (20) weisenden Bereiche der
`Verschlusssegmente (40) in einem unteren Bereich
`voneinander b